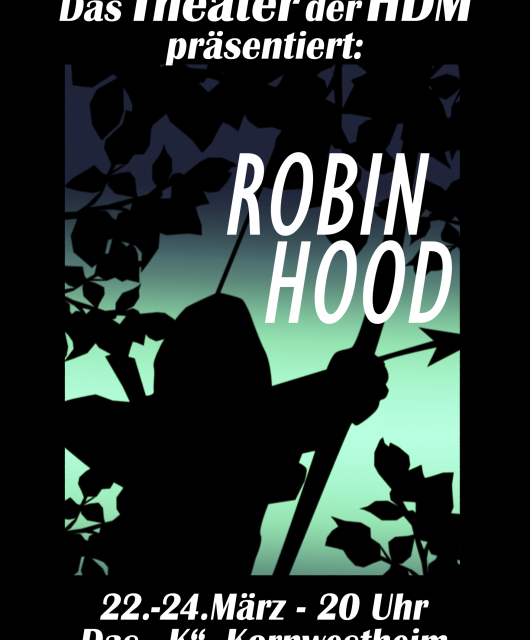Und plötzlich fühlt es sich wieder so an, als wäre ich im organisierten Chaos der Großstadt…
Ich öffne die Augen.
Es nieselt. Fahrig knöpfe ich meinen Cardigan zu, mein Blick auf die neonfarbenen Schilder gerichtet, die störrisch dem Dunkel entgegenleuchten.
Ich gehe an diversen Bars, Restaurants und Kombinis vorbei.
Auch unter der Woche ist während der Abendstunden in Akasaka viel los.
Ich biege nach rechts ab, laufe dabei halb in ein Taxi hinein, das im Begriff war, meinen Weg zu kreuzen. Verlegen nicke ich dem Fahrer zu und ermahne mich noch im selben Moment, mich nicht zu sehr von allem ablenken zu lassen.
Dennoch fällt es mir schwer zu entscheiden, wo ich meine Augen als nächstes hinrichten soll. Ich bin gefesselt wie ein Reh von den Lichtkegeln eines Autos. Hypnotisiert vom Lichterrausch – es blendet, blinkt und pulsiert.
Tokio.
Ich atme tief durch. Es riecht nach nassem Asphalt. Meine Lippen wölben sich zu einem Lächeln, meine Augen sind geschlossen.
Diffuse Stimmen und die Klänge des geschäftigen Treibens dringen an meine Ohren, eine Schulter streift die meine.
Ich schlage meine Lider auf.
Überall Menschen, die an mir vorbeiströmen.
Ich erblicke die bronzene Statue eines Hundes: Er sitzt aufrecht. Ein Ohr ist aufgestellt, das andere hängt schlapp nach unten.
Hallo, Hachiko. Unwillkürlich muss ich an den gleichnamigen Film denken, der mich als Kind sogar zum Weinen gebracht hat.
Nachdem ich einige Sekunden vor dem Denkmal innegehalten habe, setzte ich meinen Weg fort.
Jäh erheben sich Plakate, Schriftzüge und großflächige Bildschirme in die Höhe, über die unablässig Werbeclips flimmern.
Ich stocke jedoch spätestens, als ich am Straßenrand angekommen weiter nach unten sehe.
So viele Menschen. Von allen Seiten.
Lediglich der rege Verkehr auf der mehrspurigen Straße verhindert eine gewaltige Kollision. Noch.
Die Ampel schaltet auf Orange. Ich umfasse die Trageriemen meines Rucksackes fester.
Die Autos bleiben stehen. Es ist rot.
Zahllose Beine setzen sich nun in Bewegung, so auch meine.
Habe ich bislang nur Bilder oder Videos aus luftigen Höhen vom Shibuya Crossing gesehen, schwimme ich nun inmitten dieser riesigen Menschentraube, bemüht, mich möglichst geschickt an den Entgegenkommenden vorbeizuschlängeln.
Ein kurzer Seitenblick verrät mir, wie mühelos der Großteil der Passanten die Straße überquert. Ich fühle mich ungeschickt – als wäre ich ein Huhn in einem dieser rätselhaft harmonischen Starenschwärme.
Endlich habe ich es auf die andere Seite geschafft. Ich bin fast schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich entgegen aller Erwartungen mit niemandem zusammengestoßen bin.
Immerhin.
Den Kopf in den Nacken gelegt, stechen mir die großen roten Ziffern „109“ besonders in die Augen, als ich dem Ungetüm von Einkaufzentrum, das ein Mekka für stilbewusste, junge Frauen ist, näher komme.
Ich flaniere über eine breite Gasse. Musik empfängt mich, die aus Lautsprechern ertönt.
Sie ist erfrischend, verspielt – gute Laune für die Ohren.
Verträumt wippe ich meinen Kopf zum Takt. Ich schließe die Augen.
Die Musik hat sich verändert – ich schaue auf.
Sie ist weit lauter, der Bass wummert mir im ganzen Leib. Stimmen aller Art und Tonlagen stimmen in die Verse des R&B Klassikers ein. Erhobene Gläser blitzen in den farbigen Lichtkegeln, die wild über die Menge schwenken.
Roppongi.
In diesem Ausgehviertel feiern viele Internationals mit Einheimischen und umgekehrt. Die Sprachbarriere ist hier vergleichsweise klein.
Zugegeben, der Weg in die Bar oder den Club – hier werden keine Wünsche offen gelassen – kann zuweilen etwas lästig sein. Auf den Straßen wird man schon mal ganz schön aggressiv beworben, unabhängig davon, ob es jetzt um eine Shisha Bar oder eine Dönerbude geht. Dies stellt aber in der Regel kein Problem dar, solange man sich davon nicht allzu sehr beeindrucken lässt und einfach weiterläuft.
Ich werde angestupst.
Ein ertapptes Grinsen schleicht sich auf meine Lippen, als ich endlich wieder beginne zu tanzen. Ich muss wohl schon ein Weilchen wie angewurzelt herumgestanden sein.
Es ist heiß. Mehr und mehr Jacken werden im Sekundentakt abgestreift, Hemdärmel hochgekrempelt. Der Club ist rappelvoll, Gänge zur Bar oder Toilette gestalten sich allmählich zu einem Hindernislauf, bei dem die Geduld mächtig auf die Probe gestellt wird. Wie soll es auch anders sein?
Ich drehe meinen Kopf über die Schulter, bemüht, den inzwischen Vermissten aus unserer Gruppe auszumachen. Ein weißer Lichtstrahl fällt genau auf mein Gesicht, im Reflex kneife ich die Augen zusammen.
Die Musik ist erstorben, es ist fast schon still.
Mir kommen nur wenige Passanten entgegen.
Ich stehe in einer sehr schmalen Gasse, über mir verläuft ein gebündelter Strang von schwarzen Kabeln, der von Metallkonstruktionen fixiert ist. An jeder sind Zweige mit rosaroten Blüten befestigt, die zum Berühren nahe über meinem Kopf baumeln.
Auch die hölzernen Häuserfassaden sind mit Kirschblüten geschmückt.
Die Sakura-Zeit ist vorbei, jedoch sind auch jene Plastik-Imitate schön anzusehen.
Omoide-Yokocho ist wie eine kleine Welt für sich im urbanen Irrgarten Tokios.
Größer könnte der Kontrast zu riesigen Wolkenkratzern und unüberschaubaren Menschenmassen kaum sein. Die traditionell bescheidenen Holzhäuschen beinhalten Bars und winzige Grillgeschäfte.
Dieser Ort ist magisch. Geheimnisvoll. Wie aus einer anderen Zeit.
Papierlaternen leuchten im Dunkeln, der Duft von gegrilltem Gemüse und Fleisch liegt mir in der Nase. Geleitet vom Hunger, setze ich mich an einen Tresen zu meiner Linken.
Die meisten Geschäfte sind nicht im klassischen Sinne geschlossen, sondern primär überdacht.
Sitze für mehr als fünf oder sechs Personen gibt es hier drinnen (oder draußen?) gar nicht.
Zubereitet werden die gewünschten Spieße direkt vor meinen Augen und sie schmecken so gut, wie sie riechen. Sie haben aber auch ihren Preis.
Man könnte meinen, ein kleiner Schuppen wie dieser kann gar nicht so teuer sein, die anschließende Rechnung liefert mir jedoch den Gegenbeweis.
Grundsätzlich lässt sich vergleichsweise billig Essen gehen in Tokio. Möchte man also Geld sparen, sollte man es hier eher bei einem Snack belassen.
Nichtsdestotrotz bin ich heilfroh, diesen Ort gefunden zu haben.
Zufrieden knabbere ich an meinem Fleischspieß, während ich die Vorbeiziehenden beobachte.
Wenig später schlendere auch ich wieder die Gassen entlang, es ist schon spät.
Müdigkeit macht meine Glieder schwer. Gähnend reibe ich mir die Augen.
Als ich meine Lider abermals aufschlage, habe ich auch hier nicht viel Platz – gar noch weniger. Eingekesselt von Glaskästen, schiebe ich mir meinen Weg zu einer in Sachen Freiraum großzügigeren Stelle. Hunderte Actionfiguren von jeglichen Anime und Games blicken mir durch das Glas entgegen. One Piece, Naruto, Super Mario, Kingdom Hearts … die Liste ist endlos.
Das Stockwerk darunter ist gänzlich mit Manga gefüllt. Englische Ausgaben sucht man aber meist vergebens.
Ich verschränke meine Arme, brumme in mich hinein.
Hätte ich doch lieber mal lesen gelernt. Alle drei Schriften, sprich Kanji, Katakana und Hiragana, versteht sich.
Ist ja nur halb so schwer.
Schließlich trete ich aus dem mehrstöckigen Geek-Paradies, welches hier bei weitem nicht das einzige ist, hinaus auf die Straße.
Auf einem großen Plakat grinst mir ein Mädchen in Schuluniform entgegen, ihre Kulleraugen typischerweise groß und rund.
Akihabara.
Mir fällt hierzu ehrlich gesagt kein besserer Begriff als Nerd-Viertel ein und das meine ich in keinster Weise diskriminierend – habe ich mich selbst daran erfreut wie ein Schneekönig. Heutzutage ist das ja ohnehin schon fast das neue cool.
Bevor ich abschweife: hier werden Technik-, Spielkarten- und sonst alle möglichen Schnick-Schnack-Sammler, Manga- und Anime-Fans sowie Gamer definitiv nicht unglücklich.
Maid-Cafés gibt’s hier natürlich auch. Folgt man dem Straßenverlauf, wird man mindestens ein oder zwei dauergrinsenden Maids in ihren süßen Kostümchen über den Weg laufen, die mit nasal-piepsiger Stimme Werbung für ihr Café machen.
Die Zielgruppe sind hier offensichtlich die Herren der Schöpfung. Flyer werden verteilt, es wird gekichert, wobei die Hände verschüchtert vor den Mund gehalten werden – es muss kawaii sein.
Unschlüssig stehe ich am Straßenrand. Es gibt hier unheimlich viel zu entdecken, der Tag ist noch lang.
Ich schließe die Augen.
Als sich meine Augen wieder öffnen, erblicke ich erneut eine eindrucksvolle Menschenmasse, darunter viele Touristen.
Ich stehe am Hang unter einem hohen Tor, dessen silberne Lettern im Sonnenlicht schimmern.
Takeshita Street, Harajuku.
Auf dieser mehr als gut besuchten Einkaufsstraße findet man so ziemlich alles.
Vor allem, wenn es von der Norm abweicht: von Gothic über Cosplay, die neuesten Trends und nicht zuletzt auch Second-Hand.
Harajuku ist noch ein bisschen verrückter als der Rest und es kostet mich eine gute Portion Selbstbeherrschung, nicht sofort schon einige tausend Yen hier zu lassen.
Beim Schuhe probieren fühle ich mich unwillkürlich wie Big Foot, bewegt sich meine Größe hier zwischen L und LL – in Deutschland bin ich eine 38 oder 39.
In Sachen Kleidergröße ist ohnehin ein wenig Experimentierfreude angesagt.
Wird man hungrig vom Bummeln, ist man hier bestens versorgt. Das Viertel ist auch bekannt für Crêpes, die bekommt man gefühlt an jeder Ecke.
Ich bleibe vor einem liebevoll gestalteten Häuschen stehen. Es ist pastell-grün und schreit nach Vintage. Ich staune nicht schlecht über das Angebot, von salzig nach süß und wieder zurück.
Schließlich entscheide ich mich für einen Eierkuchen mit Waldbeeren und Vanille. Meine kürzlich aufgekommene Laktoseintoleranz sei jetzt einmal dahingestellt – es war super lecker und ist ein must-do in Harajuku.
Mit gefülltem Magen und schlussendlich doch mit der einen oder anderen Einkaufstüte bewaffnet, verlasse ich die Takeshita Street. Hier werde ich bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ich sitze in der Metro, das monotone Surren lullt mich zunehmend ein. Ermattet von den Strapazen des Tages, kämpfe ich tapfer gegen meine schweren Lider.
Die Nächte wurden regelmäßig lang, ausgiebig Schlafen war nicht meine beste Disziplin. Nachteulen kommen in einer Großstadt wie dieser eben auf ihre Kosten.
Am Ende muss ich mich geschlagen geben, meine Augen sind vollends zugefallen.
Der Fernseher zu meiner Seite quakt unermüdlich vor sich hin, ich schenke ihm wenig Beachtung.
Ich öffne die Augen, meine Finger ruhen immer noch auf der Tastatur. Das schwarz-weiße Fellknäuel neben mir – meine Kater – brummt mich zufrieden an. Geistesabwesend fahre ich mit einer Hand durch sein weiches Fell, was mit einem wohligen Schnurren quittiert wird. Meine Eltern sind in ein Gespräch vertieft, ich sehe sie über den Bildschirm an.
Ich bin zu Hause – über das Wochenende aus Stuttgart gekommen.
Zufrieden, behütet und doch fehlt etwas, etwas Klitzekleines.
Ich habe ein kleines Stück meines Herzens in Japan gelassen.
Die Erinnerungen an meine Zeit dort begleiten mich ständig, haben mich in vielerlei Hinsicht geprägt.
Meine Mundwinkel schieben sich nach oben, als ich den Laptop zuklappe.
Es stimmt: Japan hat viel mehr zu bieten als Tokio – aber ein bisschen Lichterrausch hat noch nie jemandem geschadet, oder?
-Vanessa Voge-
[huge_it_slider id=“12″]